Eine aktuelle Studie des The Conference Board, die über 250 Unternehmen analysiert, zeigt die zehn Prioritäten, die die Strategien für unternehmerische Nachhaltigkeit im Jahr 2025 prägen. Während politische Veränderungen an oberster Stelle stehen, offenbart die Studie ein Umfeld, in dem regulatorische Zersplitterung auf operative Komplexität trifft – und Erfolg davon abhängt, über die reine Einhaltung hinauszugehen und Nachhaltigkeit strategisch zu verankern.
Dieser Artikel beleuchtet diese Prioritäten aus der Perspektive von Nachhaltigkeitsteams, die sich den Herausforderungen der Praxis stellen, und integriert dabei Erfahrungen von Fachleuten, die die Entwicklung aus erster Hand miterlebt haben.
Politische Weichenstellungen verändern das Nachhaltigkeitsfeld grundlegend
Die größte Herausforderung für Nachhaltigkeitsfachleute im Jahr 2025 besteht darin, sich an die sich schnell wandelnden politischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Forschungen des Conference Board zeigen, dass politische Veränderungen die wichtigste Priorität im Bereich unternehmerische Nachhaltigkeit darstellen, wobei 80 % der Nachhaltigkeitsverantwortlichen ihre Strategien an die sich verändernden regulatorischen Landschaften anpassen.
Die auffälligsten Veränderungen gab es in den Vereinigten Staaten, wo die föderale Klimapolitik eine Kehrtwende hin zu einer Ausweitung der fossilen Brennstoffförderung und einer Reduzierung der Anreize für saubere Energien vollzogen hat. Der Rückzug der Securities and Exchange Commission von ihrer föderalen Regelung zur Offenlegung klimarelevanter Informationen steht für einen grundlegenden Wandel der regulatorischen Erwartungen und zwingt Unternehmen dazu, ihre Reporting-Strategien neu auszurichten.
Dieser Rückzug auf Bundesebene bedeutet jedoch nicht das Ende der Nachhaltigkeitsregulierung. Die kalifornischen Gesetze SB 253 und SB 261 behalten strenge Anforderungen an die Klimaberichterstattung für Unternehmen mit erheblichem Umsatz im Bundesstaat bei und schaffen damit ein Flickwerk unterschiedlicher regulatorischer Vorgaben, durch das sich Nachhaltigkeitsteams zurechtfinden müssen.
Unternehmen reagieren mit pragmatischen Anpassungen: 52 % schärfen oder verändern ihren ESG-Kommunikationsansatz, während 48 % die rechtlichen Prüfungs- und Risikobewertungsprozesse intensivieren. Viele Organisationen ersetzen dabei aufgeladene Begriffe wie „ESG“ durch neutralere Formulierungen wie „Nachhaltigkeit“ oder „Resilienz“, um politische Kontroversen zu vermeiden und gleichzeitig substanziell wirksame Programme fortzuführen.

Wie Christoph Bock von RTL2 Fernsehen im Rahmen der Voices of Sustainability-Initiative von Plan A feststellt:
Wenn Ihr Unternehmen von den Omnibus-Vorschlägen betroffen ist, kann es sinnvoll sein, <em>den eingeschlagenen Weg beizubehalten</em>. Die Klimakrise bleibt akut. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Nachhaltigkeitsagenda weiterhin mit Entschlossenheit voranzutreiben.
Die strategische Antwort verlangt eine Balance zwischen politischer Sensibilität und wirtschaftlichen Grundprinzipien. Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeitsstrategien an messbarer Wertschöpfung ausrichten und gleichzeitig ihre Kommunikation an die sich wandelnden Erwartungen der Stakeholder anpassen.
Regulatorische Komplexität erfordert anspruchsvolle Reporting-Ansätze
Die Regelungen zum ESG-Reporting weiten sich weltweit weiter aus und erzeugen für multinationale Konzerne eine bisher nie dagewesene Komplexität. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union bleibt trotz laufender Überarbeitungen durch die Omnibus-Initiative in Kraft, welche die Anwendbarkeit für Unternehmen außerhalb der EU von 2028 auf 2030 verschoben hat.
Die Klimaberichtspflichten in Kalifornien stehen exemplarisch für die fragmentierte regulatorische Landschaft. Das Gesetz SB 253 verpflichtet Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar in Kalifornien dazu, ihre Scope 1-3-Treibhausgasemissionen mit externer Prüfung offenzulegen, während SB 261 die Erstellung von Klimarisikoberichten nach den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) vorschreibt.

Diese regulatorische Divergenz stellt Nachhaltigkeitsteams vor strategische Entscheidungen. Einige Unternehmen setzen auf minimale Compliance-Strategien, um ihre rechtlichen Risiken – insbesondere in politisch instabilen Märkten – zu begrenzen. Andere orientieren sich an den höchsten globalen Standards, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und ihre Reporting-Fähigkeiten zukunftssicher zu gestalten.
Der effektivste Ansatz erfordert, ESG-Daten nach Finanzstandards zu behandeln. Das bedeutet, robuste interne Kontrollmechanismen einzuführen, Prüfungsausschüsse frühzeitig einzubinden und Systeme aufzubauen, die externe Prüfungsanforderungen zuverlässig unterstützen.
Die Nachweisbarkeit der Kapitalrendite wird unerlässlich
Der Druck, einen messbaren Return on Investment (ROI) für Nachhaltigkeitsinitiativen nachzuweisen, hat deutlich zugenommen. Nur 9 % der befragten Führungskräfte bewerten ihre Fähigkeit zur Messung des Nachhaltigkeits-ROI als gut oder sehr gut, während 38 % diese als unzureichend einschätzen – ein deutliches Indiz für eine kritische Kompetenzlücke.
Diese Herausforderung bei der Kapitalrendite spiegelt umfassendere wirtschaftliche Zwänge wider. Inflation, Unterbrechungen in der Lieferkette und geopolitische Unsicherheiten haben die Kontrollmechanismen von Führungskräften gegenüber allen Investitionen, einschließlich Nachhaltigkeitsprogrammen, verschärft. Aufsichtsräte und Vorstandsebene erwarten glaubwürdige Nachweise, dass Nachhaltigkeitsinitiativen die operative Effizienz steigern, Risiken mindern und zur langfristigen Wertschöpfung beitragen.
Die wirkungsvollsten Nachhaltigkeitsteams setzen auf direkte, messbare Ergebnisse. Energieeffizienzprogramme bieten dabei meist den eindeutigsten Nachweis für eine positive Kapitalrendite, da Unternehmen durch optimierten Energieverbrauch Kosteneinsparungen von 10 bis 30 % erzielen. Auch Wasserschutzmaßnahmen schaffen vergleichbare Transparenz, insbesondere für Produktionsbetriebe in wasserarmen Regionen.
McKinseys Analyse von über 2.200 Unternehmen zeigt, dass sogenannte „Triple Outperformer“, also Unternehmen mit herausragenden Ergebnissen in Wachstum, Rentabilität und ESG, eine jährliche Gesamtrendite für Aktionäre erzielen, die um 2 Prozentpunkte höher liegt als bei rein finanziell agierenden Unternehmen und um 7 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der übrigen Unternehmen.
Eine glaubwürdige ROI-Messung erfordert abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Nachhaltigkeitsteams müssen eng mit den Bereichen Finanzen, Einkauf, Personal und Betrieb zusammenarbeiten, um einheitliche Messrahmenwerke und gemeinsame Verantwortungsstrukturen zu etablieren.
Klimastrategie entwickelt sich weiter – über reines Compliance hinaus
Die Klimastrategie bleibt eine grundlegende Priorität, da über 80 % der Unternehmen im S&P 500 inzwischen öffentlich den Klimawandel als Geschäftsrisiko einstufen. Dabei verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend von der bloßen Offenlegung hin zur strategischen Verankerung in den Kerngeschäftsprozessen.
Die fortschrittlichsten Unternehmen verankern Klimafaktoren systematisch in ihren Rahmenwerken für das Risikomanagement, in Prozessen zur Kapitalallokation sowie in Vergütungsstrukturen für Führungskräfte. Diese Integration berücksichtigt sowohl physische Risiken wie extreme Wetterereignisse, Dürren und Überschwemmungen als auch Übergangsrisiken im Zusammenhang mit politischen Veränderungen und sich wandelnden Offenlegungspflichten.
Scope-3-Emissionen stellen die größte strategische Herausforderung dar. Diese indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungsketten machen in der Regel 65–75 % des gesamten CO₂-Fußabdrucks eines Unternehmens aus und sind zugleich die am schwierigsten zu erfassenden und zu beeinflussenden Emissionen. Unternehmen investieren daher in Programme zur Lieferantenbindung, verbesserte Systeme zur Datenerfassung sowie branchenübergreifende Kooperationsinitiativen, um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen.

Wie Nathan Bonnisseau, Mitgründer von Plan A, feststellt:
Eine Plattform, die Sie zu den effektivsten Maßnahmen führt und Emissions-Hotspots klar aufzeigt, zeigt, wo Technologie wirklich einen Unterschied macht.
Transparenz in der Lieferkette schafft Wettbewerbsvorteile
Die Nachhaltigkeit in der Lieferkette hat sich von einer reinen Compliance-Anforderung zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil entwickelt. Unternehmen erkennen, dass die meisten Umwelt- und Sozialauswirkungen, einschließlich Scope-3-Emissionen, Abholzung und Menschenrechtsfragen, in den vorgelagerten Bereichen ihrer Wertschöpfungsketten entstehen.
Der regulatorische Druck beschleunigt diesen Wandel. Die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) und die Verordnung für entwaldungsfreie Produkte werden viele Unternehmen, darunter auch große multinationale Konzerne mit Sitz in den USA, dazu verpflichten, Umwelt- und Menschenrechtsrisiken in ihren globalen Geschäftsaktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu bewältigen.
Das Uyghur Forced Labor Prevention Act zeigt, wie geografisch gezielte Vorschriften die Praktiken globaler Lieferketten verändern können. Obwohl der Fokus auf der chinesischen Region Xinjiang liegt, signalisieren die Anforderungen an die Einhaltung, darunter durchgängige Rückverfolgbarkeit, externe Prüfungen und umfassende Sorgfaltspflichten bei Lieferanten, weiterreichende Erwartungen an die Transparenz in der Lieferkette.
Unternehmen reagieren mit mehrstufigen Ansätzen. Die ersten Maßnahmen konzentrieren sich auf die Lieferanten der ersten Ebene, wobei klare Erwartungen definiert und Überwachungssysteme eingerichtet werden. Fortgeschrittene Programme erhöhen die Transparenz auch bei Lieferanten der zweiten und dritten Ebene, in denen viele der risikoreichsten Aktivitäten stattfinden.
Mehr als die Hälfte der im Mai 2025 von The Conference Board befragten Unternehmen gab an, ihren Fokus auf Menschenrechte in Lieferketten verstärkt zu haben. Dabei haben 7 % ihre Anstrengungen deutlich ausgeweitet und 45 % ihre Aufmerksamkeit für diese Themen zumindest etwas erhöht.
Frage: „Hat Ihre Organisation im Jahr 2025 aufgrund der sich entwickelnden politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den USA und Europa ihren Fokus auf Menschenrechte in der Lieferkette verändert?“
Befragte: 29 Teilnehmer der Umfrage:
Die wirkungsvollsten Nachhaltigkeitsprogramme in der Lieferkette verbinden technologische Lösungen mit branchenübergreifenden Kooperationsinitiativen. Unternehmen investieren in blockchainbasierte Rückverfolgbarkeitssysteme, satellitengestützte Überwachung zur Erkennung von Entwaldungsrisiken sowie gemeinsame Bewertungsplattformen für Lieferanten, um die Transparenz zu erhöhen und gleichzeitig den individuellen Compliance-Aufwand zu reduzieren.
Wassermanagement geht auf lokale Risiken ein
Wassermanagement hat sich zu einer zentralen Priorität entwickelt, insbesondere für Unternehmen, die in wasserknappen Regionen tätig sind. Anhaltende Dürreperioden im Südwesten der USA, in Texas und im Einzugsgebiet des Colorado River haben die physischen und regulatorischen Risiken für wasserintensive Branchen deutlich verschärft.
Die Daten zum Wasserverbrauch von Unternehmen zeigen positive Entwicklungen: Der Medianverbrauch der S&P-500-Unternehmen sank von 2,4 Millionen Kubikmetern im Jahr 2022 auf 1,7 Millionen Kubikmeter im Jahr 2024. Diese Reduktion ist auf Effizienzsteigerungen sowie strategisches Risikomanagement zurückzuführen.
Wasserstrategien werden zunehmend regionalisiert. Unternehmen führen Bewertungen auf Einzugsgebietsebene durch, um die regionale Wasserverfügbarkeit besser zu verstehen, und setzen wissenschaftlich fundierte Ziele um, die an den lokalen Wasserstress angepasst sind. Fortschrittliche Recyclingtechnologien und präzise Bewässerungssysteme reduzieren den Verbrauch, während die operative Effektivität erhalten bleibt.
.avif)
Die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren ist entscheidend für ein wirkungsvolles Wassermanagement. Unternehmen kooperieren mit kommunalen Behörden, landwirtschaftlichen Organisationen und Umweltverbänden, um gemeinsame Strategien für die Wasserbewirtschaftung zu entwickeln, die langfristige Betriebsstabilität gewährleisten und gleichzeitig den Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht werden.
Die Biodiversität rückt als strategische Priorität in den Fokus
Die Biodiversität hat als unternehmerische Nachhaltigkeitspriorität erheblich an Bedeutung gewonnen: 59 % der Unternehmen im S&P 500 verfügen inzwischen über Biodiversitätsrichtlinien, verglichen mit 29 % im Jahr 2021. Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Erkenntnis wider, dass natürliche Ökosysteme die Grundlage für Ernährungssicherheit, Wasserverfügbarkeit, Klimastabilität und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit bilden.
Der Rahmen der Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) fördert die systematische Bewertung naturbezogener Risiken und Chancen. Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Rohstoffgewinnung sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie stehen im Fokus, da ihre Abhängigkeit von natürlichen Ökosystemen und mögliche Auswirkungen auf die Biodiversität besonders genau geprüft werden.
Die Herausforderungen bei der Umsetzung sind erheblich. Die Auswirkungen auf die Biodiversität sind stark standortspezifisch und lassen sich nur schwer konsistent messen, was die Zielsetzung und das Reporting erschwert. Unternehmen mit komplexen Lieferketten stehen zudem vor zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Bewertung und Steuerung von Biodiversitätsrisiken über verschiedene Regionen und Ökosystemtypen hinweg.
Die wirkungsvollsten Biodiversitätsstrategien konzentrieren sich auf zentrale Themen, die eng mit den Geschäftsprozessen verknüpft sind. Lebensmittel- und Agrarunternehmen gehen den Rückgang der Bestäuber und die Bodengesundheit durch regenerative Landwirtschaftspraktiken an. Unternehmen aus den Bereichen Extraktion und Infrastruktur legen ihren Fokus auf Flächennutzungsplanung und Wiederherstellung von Lebensräumen. Konsumgüterunternehmen betonen nachhaltige Beschaffung und Verpackungsmaterialien.
Investitionen in Rückverfolgbarkeitssysteme, geospatiales Monitoring und lokale Partnerschaften fördern diese Initiativen. Unternehmen nutzen Satellitenbilder, Blockchain-Technologie und Vor-Ort-Verifizierungen, um die Transparenz der Biodiversitätsauswirkungen entlang ihrer Wertschöpfungsketten zu erhöhen.
Die Integration ins Kerngeschäft beschleunigt die Wirkung von Nachhaltigkeit
Die Integration von Nachhaltigkeit in die zentralen Geschäftsbereiche markiert einen grundlegenden Wandel von isolierten Programmen hin zu fest verankerten operativen Abläufen. Umfragedaten zeigen hierbei deutliche Unterschiede im Fortschritt zwischen den Abteilungen, wobei Recht, Einkauf, Betrieb und Kommunikation die höchste Integrationsstufe aufweisen.
Finanzen und Personalwesen hinken bei der Integration von Nachhaltigkeit deutlich hinterher. Nur 12 % der Unternehmen geben an, in diesen Funktionen eine hohe Integration erreicht zu haben – trotz ihrer entscheidenden Rolle bei der Kapitalallokation, der Personalentwicklung und der langfristigen strategischen Planung. Diese Lücke verringert die Wirksamkeit von Nachhaltigkeitsinitiativen und begrenzt deren potenziellen geschäftlichen Impact.
Viele Unternehmen setzen hybride „Hub-and-Spoke“-Modelle ein, um Integrationsherausforderungen zu bewältigen. Ein zentrales Nachhaltigkeitsteam entwickelt die Strategie, steuert das Reporting und übernimmt die externe Kommunikation, während die Fachbereiche die Umsetzung in ihren jeweiligen Bereichen verantworten.
Eine erfolgreiche Integration setzt klare Verantwortungsstrukturen und Leistungsmotivation voraus. Unternehmen verankern Nachhaltigkeitskennzahlen zunehmend in der Vergütung von Führungskräften, in den Abteilungszielen und in den Bewertungskriterien von Projekten, um ein einheitliches Verhalten im gesamten Unternehmen zu fördern.
Wie Dany Leroux, Nachhaltigkeitsmanager bei L'Oréal Italia, hervorhebt:
Nachhaltigkeitsmanager sollten nicht das Monopol auf die soziale und ökologische Transformation in ihren Unternehmen haben. Vielmehr gilt es, die Verantwortung auf alle Teams zu verteilen und zu delegieren, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Nachhaltigkeitsgeschichten stärken das Engagement der Anspruchsgruppen
Wirksames Nachhaltigkeitsstorytelling ist unerlässlich geworden, um unterschiedliche Anspruchsgruppen einzubinden und die Ziele unternehmerischer Nachhaltigkeit voranzutreiben. Während regulatorische Vorgaben für einheitliches ESG-Reporting sorgen, erkennen Unternehmen zunehmend den strategischen Wert überzeugender Erzählungen, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen.
Umfragedaten zeigen, dass 37 % der US-amerikanischen und 36 % der europäischen Unternehmen nach wie vor auf traditionelle, datenlastige Berichte mit minimalem Erzählelement setzen. Gleichzeitig experimentieren viele mit kreativeren Ansätzen, darunter interaktive Formate, visuelles Storytelling und zielgruppenspezifische Inhalte.

Die wirkungsvollsten Geschichten zur Nachhaltigkeit verbinden prüfungsreife Daten mit praxisnahen Beispielen. Unternehmen rücken dabei Mitarbeiter, Gemeinschaften und Partner in den Fokus, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen greifbarer und nachvollziehbarer zu machen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Nachhaltigkeit stärker in der Unternehmenskultur zu verankern und gleichzeitig Marken in wettbewerbsintensiven Märkten klar zu differenzieren.
Die Kommunikation muss auf verschiedene Stakeholder-Gruppen zugeschnitten sein. Investoren und Regulierungsbehörden legen Wert auf Wesentlichkeit und messbare Ergebnisse, während Mitarbeiter und Kunden stärker auf Zweck, Wirkung und Authentizität reagieren. Erfolgreiche Unternehmen entwickeln Content-Strategien, die diese unterschiedlichen Erwartungen berücksichtigen und gleichzeitig konsistente Kernbotschaften vermitteln.
Technologieplattformen eröffnen anspruchsvollere Erzählformen. Interaktive Dashboards, Virtual-Reality-Erlebnisse und Augmented-Reality-Anwendungen ermöglichen es den Stakeholdern, auf eine eindringliche Weise mit Nachhaltigkeitsdaten zu interagieren, wie es traditionelle Berichte nicht bieten können.
Künstliche Intelligenz bietet Chancen und Risiken
KI hat sich sowohl als Instrument für unternehmerische Nachhaltigkeit als auch als eine Herausforderung in diesem Bereich etabliert. Unternehmen sehen Chancen, KI für die Emissionsprognose, Energieoptimierung und Identifikation von Risiken in der Lieferkette zu nutzen, während sie gleichzeitig mit den ökologischen und sozialen Risiken des KI-Einsatzes umgehen müssen.
Umfragedaten zeigen unterschiedliche Einschätzungen zum Einfluss von KI auf die Nachhaltigkeit. 54 % der Unternehmen sehen darin ökologische Chancen, während 34 % ökologische Risiken erkennen. Die sozialen Aspekte sind noch ambivalenter: 57 % sehen Chancen, 53 % hingegen Risiken.

Unmittelbare Anwendungsbereiche konzentrieren sich auf ESG-Reporting und Datenmanagement. Generative KI kann die Erstellung von Berichten vereinfachen, indem sie große Datensätze zusammenführt, die Sprache an Berichtstandards anpasst und maßgeschneiderte Inhalte für verschiedene Zielgruppen erzeugt. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert, während gleichzeitig Konsistenz und Genauigkeit verbessert werden.
Fortschrittliche KI-Anwendungen bieten einen höheren strategischen Mehrwert. Machine-Learning-Algorithmen können Klimarisiken vorhersagen, Verbrauchsmuster von Energie optimieren und Schwachstellen in der Lieferkette erkennen, bevor sie zu kritischen Problemen werden. Voraussetzung dafür sind jedoch eine ausgeklügelte Dateninfrastruktur und umfassende Analysefähigkeiten.
Die ökologischen Kosten beim Einsatz von KI sind erheblich. Das Training und der Betrieb großer Sprachmodelle erfordern beträchtliche Mengen an Energie und Wasser, was vor allem in Regionen mit begrenztem Zugang zu erneuerbaren Energien problematisch ist. Unternehmen müssen die Vorteile von KI gegen diese Umweltauswirkungen abwägen.
Die unternehmerischen Nachhaltigkeitsprioritäten für 2025 spiegeln eine Reifeentwicklung des Bereichs wider, bei der Unternehmen über die reine Einhaltung von Vorgaben hinausgehen und Nachhaltigkeit strategisch integrieren, um messbaren wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen. Erfolg erfordert dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen regulatorischen Anforderungen und den Erwartungen der Stakeholder sowie den Nachweis eines klaren Return on Investment.
Wie Irina Bolgari, Nachhaltigkeitsmanagerin bei La Prairie Schweiz, anmerkt:
Agil bleiben – kein Tag gleicht dem anderen im Leben eines Nachhaltigkeitsmanagers. Für mich ist die Frage, die mich antreibt: „Angesichts der aktuellen Gegebenheiten, woran kann ich am meisten arbeiten, um den größten Impact zu erzielen?“
Die Unternehmen, die in diesem Umfeld erfolgreich sein werden, sind jene, die Nachhaltigkeit fest in ihre Kerngeschäftsprozesse integrieren, Technologie nutzen, um Effizienz und Erkenntnisse zu verbessern, und dabei konsequent auf messbare Ergebnisse fokussieren. Plan A bietet die umfassende Plattform sowie fachkundige Unterstützung, die notwendig sind, um diese Prioritäten wirkungsvoll zu steuern und Unternehmen dabei zu helfen, Nachhaltigkeit von einer reinen Verpflichtung hin zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln.
Bereit, Ihre Nachhaltigkeitsstrategie für 2025 auf das nächste Level zu heben? Buchen Sie eine Demo mit den Nachhaltigkeitsexperten von Plan A und erfahren Sie, wie unsere Plattform Ihnen dabei hilft, diese entscheidenden Prioritäten zu meistern und gleichzeitig messbare Geschäftserfolge zu erzielen.



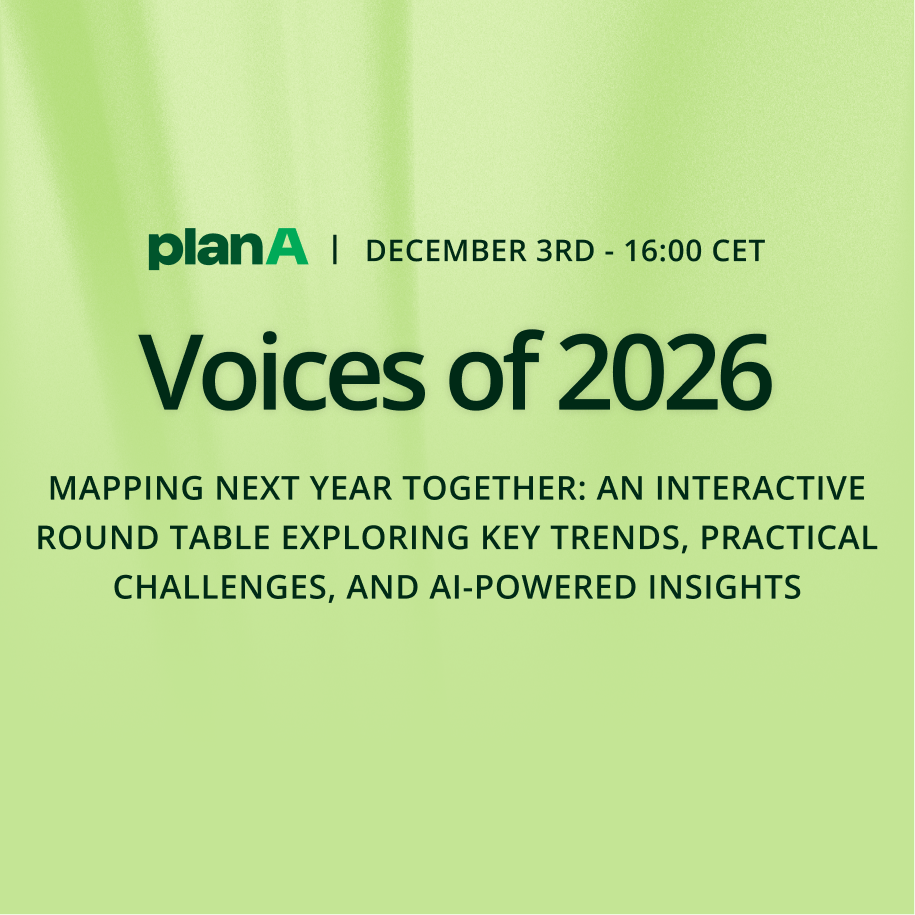
.jpg)

%20(1).jpg)
